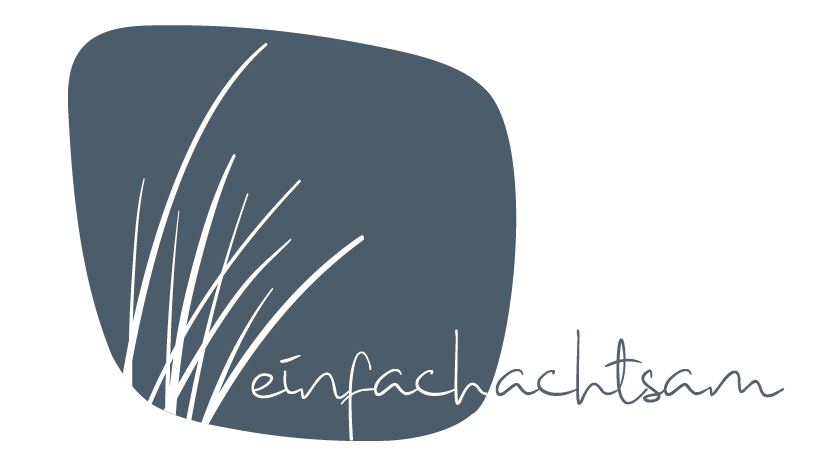„Du willst alleine reisen? Hast du keine Angst?“ Wie oft habe ich diese Fragen vor meiner Abreise nach Südamerika gehört … Und ich konnte sie schlicht nicht nachvollziehen. Das war in den Jahren 2005 und 2009. Damals hatte ich meine inneren Gründe, die so groß waren, dass da gar kein Platz für Angst war. Heute stelle ich fest, dass ich diese Frage manchmal selbst an mein altes Ich richte.
Und doch: Ich würde es immer wieder tun und auch andere dazu ermutigen. Denn alleine zu verreisen erweitert den Horizont nicht nur im geographischen Sinne und ermöglicht somit Persönlichkeitsentwicklung auf besondere Weise.
Alleine reisen
Wer alleine verreist, ist zunächst auf sich gestellt: Man muss selbst auf das Reisegepäck aufpassen, Entscheidungen allein treffen, Abfahrten organisieren, Unterkünfte finden etc.. Doch ich habe die Erfahrung gemacht, dass man überall hilfsbereiten Menschen begegnet. Was für einen selbst die Fremde darstellt, ist für andere der Alltag. Man taucht ein und wird Teil – und wenn es nur für einen kurzen Augenblick ist, in dem wir die Frage nach dem richtigen Bus stellen. Im Prinzip sind wir nirgends wirklich allein unterwegs. Wir können mit Fremden ins Gespräch kommen, ein Stück des Weges gemeinsam gehen oder mit anderen Reisenden ein paar Tage gemeinsam unterwegs sein.
Wenn wir alleine reisen, sind wir achtsamer
Wer alleine unterwegs ist, ist aufgeschlossener für Begegnungen. Der Austausch mit Unbekannten und sich für kurze Zeit auf deren Welt einzulassen, kann sehr bereichernd und erfüllend sein. Wir lernen andere Lebensweisen und neue Perspektiven kennen.
Außerdem nehmen wir die Umgebung achtsamer wahr, da wir nicht mit vertrauten Personen in Gespräche vertieft sind. Je weniger uns ablenkt, desto einfacher entdecken wir große Landschaften und kleine Details, und erleben somit intensiver.
Ein Reisetagebuch zu führen hilft, die Erlebnisse und Gedanken zu sortieren und zu verarbeiten. Außerdem erschafft man sich damit eine wunderbare Erinnerung an eine besondere Zeit. Bei mir sind aufgrund meiner Aufzeichnungen ungeplant meine ersten beiden Bücher entstanden.
Alleine verreisen und bei sich ankommen
Und doch: Wer alleine verreist, bleibt immer wieder mit sich selbst zurück. Sowohl in schwierigen Augenblicken (in dunklen, menschenleeren Straßen oder wenn man die Unterkunft nicht findet) als auch in den schönsten Momenten (wenn man den Berggipfel erreicht oder genüsslich eine Tasse Tee trinkt). Dann wünscht man sich jemanden an seiner Seite, mit dem man die Situation und die eigenen Gedanken und Gefühle teilen kann.
Doch wenn man es schafft, diese manchmal auch schwierigen Phasen mit sich selbst durchzustehen und auch die tollsten Aussichten ganz für sich allein zu genießen, dann ist man beim Unterwegssein bei sich angekommen.
Alleine verreisen ist Persönlichkeitsentwicklung
Wer alleine verreist verbringt viel Zeit mit sich selbst und erweitert den Horizont auf vielen Ebenen. Werte verschieben sich, man wächst an herausfordernden Situationen und gewinnt neue Erkenntnisse.
Das ist der Grund, warum das Alleinreisen stärker, unabhängiger und zuversichtlicher macht und Persönlichkeitsentwicklung ist. Man findet sich zurecht: In sich selbst mit sich selbst. Aber auch da draußen in der – für uns – unbekannten Welt.
Alleine reisen als Frau
Alleine reisen als Frau bringt in manchen Ländern besondere Herausforderungen mit sich, da man von Fremden oft zweideutig angequatscht wird. Ich habe selbst Momente erlebt, in denen ich plötzlich kein klares Bauchgefühl hatte und meine Menschenkenntnis den kulturellen Unterschied nicht einordnen konnte. Doch aus der Not heraus habe ich mich auf den Menschen eingelassen, der mir seine Hilfe angeboten hatte.
Diese Spannung zwischen Abenteuer und Risiko sowie Gelingen und Glücksmomenten ist Herausforderung und Reiz zugleich, wenn man alleine reist. Durch die richtige Vorbereitung über Land und Leute, das Vertrauen in die eigene Intuition sowie eine angemessene Vorsicht zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten, habe ich mich jedoch meistens sehr sicher gefühlt, auch wenn ich als Frau allein durch Südamerika gereist bin.
Gruppenreise für Alleinreisende als Einstieg
Schließlich geht es vielleicht genau darum, die eigene Komfortzone zu verlassen und dadurch innerlich zu wachsen.
Wer Angst vor dem Alleinreisen hat, kann mit kleinen Unternehmungen anfangen. Kurze Ausflüge in die Nähe oder sich einer Reisegruppe für Alleinreisende anzuschließen, können erste Schritte sein. So ist man mit zunächst unbekannten Menschen unterwegs und zugleich nicht auf sich allein gestellt. Es gibt Organisationen, die sich auf das Angebot für Gruppenreisen für Alleinreisende spezialisiert haben. Bei dieser Form des Reisens ist man gemeinsam unterwegs und hat doch immer wieder Zeiten für sich.
Gruppenreise für Alleinreisende
An meinen Achtsamkeitskursen nehmen überwiegend Alleinreisende teil. Somit biete ich heute gewissermaßen selbst die Möglichkeit einer Gruppenreise für Alleinreisende an. Natürlich nehmen an meinen Seminaren auch Paare (Pärchen, Geschwister, Freund*innen) teil, doch die meisten Personen reisen allein nach Sylt und während der Achtsamkeitswoche zu sich selbst. Denn darum geht es in meinem Angebot: Unterwegs sein und bei sich selbst ankommen. So, wie ich es selbst erlebt habe.
Aspekt Nachhaltigkeit
Im Sinne der Nachhaltigkeit würde ich Fernreisen mit dem Flugzeug nur dann unternehmen, wenn man mehrere Monate dafür Zeit hat. Ansonsten erreicht man auch mit der Bahn oder zu Fuß spannende Orte. Letztlich geht es beim Alleinreisen mindestens genauso sehr um das innere Entdecken, auch wenn das vielleicht nicht die vordergründige Absicht ist.
Alleine reisen als Frau: Mein Reisetagebuch
„Dass das Sammeln immaterieller Momente viel leichter ist, aber wesentlich schwerer wiegt, ist wohl die beste Erkenntnis meiner Reise. Denn das Substanzlose erschwert den Rucksack nicht, aber bereichert die Seele.
Reisen bedeutet, leben lernen.
Das Leben selbst als Reise zu begreifen.
Denn die kleine Reise ist ein Sinnbild der großen Reise.“
Aus meinem Buch „Zwischen den Zeilen reisen„